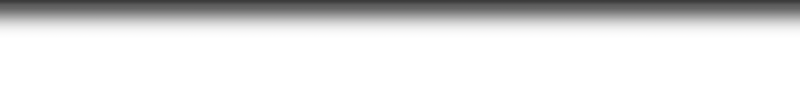
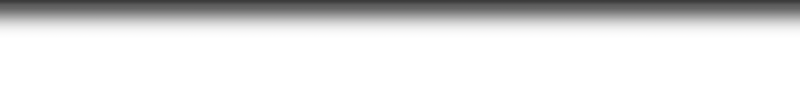
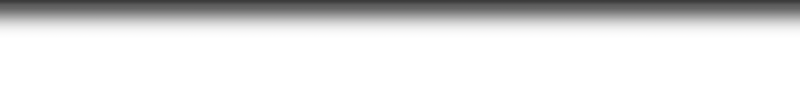
Du warst ein Tempel,
ein zartes Pantheon,
die wuchernde Kraft aus
zwölf Säulen billigstem Beton
auf Berliner Boden.
Schwarze Kohlenschlacke umsäumt unsere Geschichten – die Biografien derer, die unvollständig weitergelebt werden, die Biografien derer, die gebrochen wurden, die sie gebrochen haben wollten, die sie nicht wussten, wie schmerzhaft so ein Knochenbruch sein würde und dass die getrennten Sollbruchstellen schief zusammenwachsen würden.
Sie wussten es ja.
Ihr habt das Geld angerufen:
„Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr!“
Und sie kam.
Und mit ihr der Treibsand, auf dem ihr steht, grauer Boden, der ausgehoben
wird, um in den tiefen Sedimenten verdrängter Geschichten zu graben.
Ihr tauscht im Wechselkurs 2:1.
Zwei Geschichten, eine Schaufel. Zwei Geschichten, eine Schaufel und so weiter.
Mal sehen, was ihr so finden werdet.
Mal sehen, wie viel zerschlagenes Zwiebelmuster unsere Hände zerschneiden werden.
Mal sehen, wie tief ihr graben müsst, um zu verstehen, dass unsere Geschichten nicht dieselben sind. Dass uns unsere Geschichte nicht vereint, dass diese Vereinigung kein Erfolg war, dass wir nicht über Los gegangen und keine Häuser gekauft haben.
Nicht verdampfen, denke ich und schaue auf Asbeststeine in Vitrinen, als wären sie mehrere Jahrtausende alt und kündigten den Abriss des Palastes 2005 n. Chr. an.
Welche treuen Hände graben da eigentlich?
Wie so viele Orte wird auch dieser hier verschwinden.
Wie kann ich da nicht nostalgisch werden?
Ich stehe am Rand, wie ich immer an Rändern stehe und in schwarze Löcher schaue. Amalgam werdet ihr verwenden und es wird Generationen brauchen, diese Füllungen wieder zu entfernen. Die Löcher wieder freizulegen, in sie hineinzusprechen und unserem Echo zuzuhören.
Wir werden alle Kräfte benötigen, dem puckernden Schmerz einen Namen zu geben.
Wir werden ein paar Drogen benötigen, um das Trauma zu wecken und ich werde meine Augenbrauen zupfen, um meinen Ausdruck zu verändern und ein paar Jahre brauchen, bevor ich sie wieder wachsen lasse.
Jetzt schauen wir auf Displays. Wir schauen in das Tiefschwarz hinter der Glasscheibe, hoffend auf eine Nachricht und glaubend an die Traurigkeit, die uns anhaftet, wenn wir versuchen, das Telefon wach zu schütteln oder mit unserem Gesicht zu entsperren.
Warum nehmen wir nicht unsere Körper, heben sie hoch, vibrieren sanft und schütteln uns ein wenig wach? Ist es nicht an der Zeit, Zähne zu zeigen?
Ich frage mich, wie sich schon einige gefragt haben, warum wir nicht ein paar von diesen Löchern lassen, ein paar charmante Zahnlücken, durch die wir hindurch spucken können, lassen, ein paar der schief gewachsenen Zähne, an denen sich unser Blick heften kann, lassen.
Und ich frage mich, wie sich schon einige gefragt haben, warum wir keine Lücken lassen können?
Wir müssen darum kämpfen, die Begriffe wieder zu öffnen, sie aufzuhebeln, sie offen zu halten und uns Platz zu machen zwischen den Buchstaben und deren Bedeutung. Wir müssen die Geschichte auswringen, sie in die Sonne hängen zum Trocknen auf den Wäscheleinen im Innenhof, die es nicht mehr gibt, um uns mit ihr den Fieberschweiß von der Stirn zu wischen.
Erinnerung stirbt mit ihrer Abgeschlossenheit.
Das lehrt uns aber niemand.
Wie so viele Orte wird auch dieser hier verschwinden.
Warum sollte ich da nostalgisch sein?
Wusstet ihr, dass Kaufhof eine eigene Siebdruckwerkstatt hatte?
Wusstet ihr, dass ich in der 9. Klasse ein Praktikum zur Schauwerbegestalter_in gemacht habe und wusstet ihr, dass ich in der World of Music immer eine CD mehr in die Hülle getan habe und sie mir beiläufig in meinem Rucksack gefallen ist? Und wusstet ihr, dass ich mit meinen ersten Inline-Skates selbstverständlich rausgerollt und genau diesen Ort hier, Tag für Tag, berührt habe?
Ich wusste es ja.
Jeder meiner Wege endete im 17. Stock, jeder Müllbeutel fiel 51 Meter tief und je eine Vogelspinne befand sich an der Zimmerwand meines Bruders, die durch Mütterhände mit dem Pantoffel totgeschlagen und einen untertellergroßen Fettfleck hinterlassen würde. Die Aussicht war brillant, der glitzernde Fernsehturm auf Augenhöhe und die Faschos auf der Straße schrumpften zu einem Haufen brauner Scheiße. Ich schaute ihnen zu, Woche für Woche, Monat für Monat liefen sie stolz die Frankfurter Allee entlang, bis sie hinter der billigen Verschalung aus Dämmwolle verschwanden.
Ich traf sie im Fahrstuhl wieder, atmete ihren faulen Zigarettenrauch ein und schaute auf ihre frisch geöffnete Bierdose. Es sollte später erst ein Rauchmelder eingebaut werden und ich zwischen dem 17. und 18. Stockwerk über mehrere Stunden alleine feststecken. Seitdem denke ich, ist der Fahrstuhl der kleinste soziale Raum.
Schauen wir uns den Ort genau an.
Wir riechen die warme Luft, spüren unsere schweren Zungen und berühren die stummen Zeug*innen aus Beton. Ein versteinertes und wieder in Form gegossenes Skelett. Wir fühlen ihre Oberfläche, ihre materielle Struktur, die uns gefällt, und sie berührt uns zurück. Merleau-Ponty nennt diese Berührung „doppelte Empfindung oder auch Selbstberührung“. In „Phänomenologie der Wahrnehmung“ schreibt Ponty: „Während Wahrnehmungsobjekte vor mir stehen und vor meinen Blick entfaltet werden können, bleibt mein Leib immer am Rand meiner Wahrnehmung, sodass er nie vor mir ist, aber immer >>mit mir<< (Merleau-Ponty 1966, 115) und weiter schreibt Ponty: „Stellen wir uns vor, dass wir, wenn wir (etwas) berühren, uns selbst nicht berührt fühlen. Unsere Hand kann berühren, wird aber im Gegenzug nicht selbst berührt. Was wäre das für eine Erfahrung? Wäre es noch Berührung?“
Du warst ein Portikus,
ein zarter Altar,
die schwelende Unentschlossenheit aus
zwölf Säulen verschlossenen Asbests
auf Berliner Boden.
Jetzt wringst du den warmen Waschlappen aus,
nimmst einen Schluck von deinem abgestandenen Bier
und hältst es dir an die Stirn.
Der Fernseher läuft warm, stumm flackern die Bilder im Hintergrund.
Kennst du diese Bilder? Die Bilder aus Berlin?
Von den einstürzenden Pergolen und Hochhäusern?
Wann genau hast du beschlossen, dich aufzugeben?
Schauen wir uns den Ort.
Schauen wir genau hin, wie ich mit langen blonden Haaren und breiten Baggy-Pants hier entlang renne. Schauen wir genau hin, wie ich außer Atem bin und die hintere Eingangstür zur Platte gerade so hinter mir zugeschlagen bekomme. Und schauen wir genau hin, wie sie ihr schweißnasses Gesicht an die Glasscheibe drücken, ich ihnen meinen Mittelfinger zeige und spucke und nicht mehr aufhöre zu spucken, bis ihre Gesichter verschwinden. Ich werde sie wohl wieder treffen und die Szene wird sich ein paar Mal wiederholen, während Schauspielerkinder aus dem Fenster meiner Schule geworfen werden.
Meine Spuckefäden tropfen langsam vor unsere Haustür, bis eine kleine Pfütze entsteht. Beim Verlassen der Wohnung wird sie getrocknet sein.
Ich will nicht verdampfen.
Unsere Briefkästen explodieren, einer nach dem anderen.
Das Echo schafft es bis in den 17. Stock.
Ich stehe auf weichem Teppichboden.
Etwas festzuhalten fällt mir schwer, etwas zu erinnern nicht.
Durch den Türschlitz steigt dichter Zigarettenrauch bis an die Zimmerdecke.
Ich liege im Bett und halluziniere, tropfe gleichmäßig in die Matratze.
Mit meinen lang gewachsenen Armen berühre ich die Raufasertapete und fühle eine Landschaft, die ich nie kennenlernen werde, das erahne ich.
Im Fiebertraum imaginiere ich zu der Musik von Mariah Carey, wie ich ihren Körper berühre, dabei halte ich Alf im Arm und zwirbel die langen rot-braunen Kunststoffhaare. Ich will mich in ihnen auflösen, verberge mein Gesicht und masturbiere. Ich spüre, wie die Platte vibriert. Das feine Echo gelangt bis in meinen Magen. Sanft legt sich der kalte Rauch in die Poren meines Körpers ab. Music Box läuft in Endlosschleife, bis ich irgendwann einschlafe und den immer selben Traum träume. Zehn Jahre wird er anhalten.
Meine Großeltern nennen meine Mutter nicht bei ihrem Namen.
Schauen wir uns den Ort genau an,
wie wir hier stehen und den Boden festdrücken, einander Sorgenfalten erkennen und Körper sind. Unsere Körper beginnen hier, sie sind Spuren einer Erscheinung, sie sind Körper in anderen Körpern, sie provozieren Übergänge in Räume, die wir noch nicht kennen.
An welchen Stellen berühren sich unsere Biografien?
Fabian Saul schreibt in „Die Trauer der Tangente“: „Ein Ort lag schon immer im anderen“ und ich will ergänzen, ein Ort lag schon immer im anderen und wir wussten ja von diesem.
Du bist eine moderne Ruine,
ein zarter Müllhaufen,
die entzündete Wahrsagung aus
zwölf Säulen verhärteter Geschichte
auf Berliner Boden.
You were a temple,
a tender pantheon,
the rampant force of
twelve columns of the cheapest concrete
on Berlin soil.
Black coal slag frames our stories—
the biographies of those who continue to live incompletely,
the biographies of those who were broken,
by those who wanted them broken,
by those who didn’t know how painful a broken bone would be
and that the intended fracture lines would heal crooked.
But they knew.
They called out to the money:
"If the Deutschmark comes, we stay. If it doesn't, we’ll go to it!"
And it came.
And with it, the quicksand beneath your feet—
gray ground excavated to dig through the deep sediment of suppressed histories.
You trade at an exchange rate of 2:1.
Two stories, one shovel. Two stories, one shovel, and so on.
Let’s see what you’ll find.
Let’s see how many shards of blue onionware will cut our hands.
Let’s see how deep you’ll have to dig to understand that our stories are not the same.
That history does not unite us, that this reunification was no success,
that we didn’t pass “Go” and didn’t buy any houses.
I think: don’t evaporate—
and I look at asbestos stones in vitrines
as if they were millennia old and announced the palace’s demolition in the year 2005 AD.
Whose loyal hands are digging there, anyway?
Like so many places,
this one too will vanish.
How could I not feel nostalgic?
I stand at the edge, as I always do—
on edges, gazing into black holes.
You’ll use amalgam, and it will take generations
to remove those fillings again.
To reopen the cavities, to speak into them
and listen to our own echo.
We’ll need all our strength to give the pulsing pain a name.
We’ll need a few drugs to awaken the trauma,
and I’ll pluck my eyebrows to change my expression,
and it’ll take a few years before I let them grow back.
Now we stare at displays.
We stare into the deep black behind the glass pane,
hoping for a message, believing in the sadness that clings to us
when we try to shake the phone awake or unlock it with our face.
Why don’t we take our bodies, lift them up, vibrate gently,
and shake ourselves a little awake? Isn’t it time we showed our teeth?
I wonder, as others have wondered before:
Why don’t we leave a few of those gaps?
A few charming missing teeth to spit through—
a few of those crookedly grown teeth our gaze can hold on to.
And I wonder, as others have too:
Why are we so afraid of leaving gaps?
We have to fight to pry open the terms,
to wedge them apart,
to keep them open and carve out space
between the letters and their meaning.
We have to wring out history, hang it in the sun on the clotheslines in courtyards
that no longer exist, and use it to wipe the fever sweat from our brows.
Memory dies when it’s sealed shut.
But no one teaches us that.
Like so many places,
this one too will vanish.
Why should I not feel nostalgic?
Did you know that Kaufhof had its own screen-printing studio?
Did you know I did an internship in 9th grade to become a window display designer?
And did you know that in the World of Music, I always slipped an extra CD into the case
and let it casually fall into my backpack?
And did you know that with my first pair of inline skates
I naturally rolled outside and touched this very place,
day after day?
Of course I knew.
Every path I took ended on the 17th floor, every trash bag fell 51 meters down,
and at least one tarantula lived on my brother’s wall, crushed by our mother’s slipper,
leaving a grease stain the size of a small plate.
The view was brilliant.
The sparkling TV tower at eye level, and the fascists on the street
shrunk to a heap of brown shit. I watched them week after week,
month after month, as they proudly marched down Frankfurter Allee
until they disappeared behind the cheap cladding of insulation wool.
I met them again in the elevator, breathed in their stale cigarette smoke,
and looked at their freshly opened beer cans.
Smoke detectors would be installed later— but not before I got stuck
for hours between the 17th and 18th floor.
Since then, I’ve thought: the elevator is the smallest social space.
Let’s look closely at this place.
We smell the warm air, feel our heavy tongues,
and touch the silent witnesses made of concrete.
A petrified skeleton, recast into form.
We feel its surface, its material texture that pleases us,
and it touches us back.
Merleau-Ponty calls this kind of touch
a “double sensation” or “self-touch.”
In Phenomenology of Perception, he writes:
“While perceptual objects stand before me
and can unfold within my gaze, my body always remains
at the margin of my perception, so that it is never before me,
but always with me” (Merleau-Ponty 1966, p. 115).
And he goes on to write: “Let us imagine that when we touch something,
we do not feel ourselves being touched.
Our hand can touch, but in return, it does not feel itself being touched—
what kind of experience would that be?
Would it still be touch?”
You were a portico,
a tender altar,
the smoldering indecisiveness of
twelve columns of sealed asbestos
on Berlin soil.
Now you wring out the warm washcloth,
take a sip of your stale beer,
and press it against your forehead.
The television hums,
images flicker silently in the background.
Do you know these images?
The images of Berlin?
Of the collapsing pergolas and high-rises?
When exactly did you decide to give up?
Let’s look at the place.
Let’s look closely,
how I run through here with long blond hair
and wide baggy pants.
Let’s look closely,
how I’m out of breath and just manage to slam the back door
of the Plattenbau (prefab building) shut behind me.
And let’s look closely,
how they press their sweaty faces
against the glass pane,
how I flip them off and spit, and keep spitting
until their faces disappear.
I will see them again,
and the scene will repeat itself a few times,
while theater kids are thrown out the window
of my school.
My threads of spit drip slowly in front of our door
until a small puddle forms.
By the time I leave the apartment,
it’ll have dried.
I don’t want to evaporate.
Our mailboxes explode, one after another.
The echo reaches the 17th floor.
I stand on soft carpet.
It’s hard to hold onto something,
not hard to remember.
Thick cigarette smoke rises
through the crack in the door
to the ceiling.
I lie in bed and hallucinate,
slowly soaking into the mattress.
With my long grown arms,
I touch the woodchip wallpaper
and feel a landscape
I know I will never get to know—
I sense that.
In my fever dream,
I imagine— to the music of Mariah Carey—
touching her body, while holding Alf in my arms
and twirling his long reddish-brown synthetic hair.
I want to dissolve in it, hide my face, and masturbate.
I feel the building vibrate.
The faint echo settles in my stomach.
The cold smoke softly lays itself
into the pores of my body.
Music Box plays on loop
until I eventually fall asleep
and dream the same dream again.
It will last ten years.
My grandparents don’t say my mother’s name.
Let’s look closely at this place—
how we stand here, pressing into the ground,
recognizing worry lines in one another,
and being bodies. Our bodies begin here—
they are traces of a presence,
they are bodies within other bodies,
they provoke transitions
into spaces we don’t yet know.
Where do our biographies touch?
Fabian Saul writes in The Grief of the Tangent:
“A place has always been inside another.”
And I want to add:
A place has always been inside another—
and we knew, we did know this.
You are a modern ruin,
a tender pile of garbage,
the inflamed prophecy of
twelve columns of hardened history
on Berlin soil.
BETON #23
Performative Lesung / Performative reading
(23.03.2025, Müncheberger Str. 2, 10243 Berlin)







* Text „Zarter Müllaufen”
* Lesung (ca. 10 min.)
* Perfomance
* Text „Tender pile of garbage”
* Reading (ca. 10 min.)
* Perfomance
